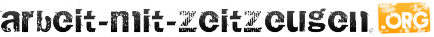Podium | Komplexe Diskurse: Zeitzeugen und ihre Rezeption
In diesem Podium wurde die Komplexität der Erzählungen von Zeitzeugen in der Interaktion mit den Rezipierenden beleuchtet. Aus den Perspektiven von Geschichtsdidaktik, Museumsarbeit und Sozialpsychologie wurden theoretische und empirische Analysen der Rezeptionsseite von Zeitzeugenarbeit in der außerschulischen und schulischen Bildung vorgestellt.
Prof. Dr. Michele Barricelli, Geschichtsdidaktiker an der Universität Hannover, stellte Thesen zur notwendigen Komplexität von Zeitzeugenberichten und deren Rezeption vor und bezog insbesondere US-amerikanische Theoriebildungen in seine Konzeption von Zeitzeugenschaft mit ein.
Er fokussierte dabei zunächst auf die Narrativität der Diskurse im Sinne einer sinnbildenden Identitätserzählung und machte auf den Widerstreit unterschiedlicher Sinnbildungslogiken aufmerksam. Basierend auf narratologischen Hypothesen von Jörn Rüsen und Hayden White identifizierte er eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten der Sinnbildung durch Geschichten, die im Gegensatz zu einfachen Aussagen eines bestimmten, ungewöhnlichen Gegenstandes bedürfen. Es gehe um eine ‚Stilisierung des selbst Erlebten, das nicht dem normalen Verlauf der Dinge entspricht‘. Sinn über derartig ‚Anstössiges‘ werde in und durch Geschichten gebildet. Unterschiedliche Sinnangebote können dabei durchaus gleichzeitig bestehen, was zur notwendigen Komplexität dieser Geschichten führe.
PowerPoint als PDF herunterladen
Darüberhinaus werde aufgrund ihrer ‚langen Lebensdauer‘, also dem Umstand, dass sie zum ersten Mal erzählt und danach oft reproduziert werden, ihre jeweilige Sinnbildung immer neu an bestehende Deutungsrahmen angepasst. (Die ‚lange Lebensdauer‘ bezog Barricelli auch auf die Zeitzeugen selbst; beispielsweise gebe es allein in Israel noch ca. 200.000 Überlebende des Holocaust; der oft gehörte Satz vom ‚Aussterben‘ der Zeitzeugen sei vielleicht manchmal ein Wunsch.) Dementsprechend betonte er die große Relevanz des Zeitpunkts des Erzählens; auch die Geschichtswissenschaft lebe nicht so sehr von neuen Quellen, als vielmehr von neuen Deutungen bereits vorliegenden Materials.
Unter dem von Jean Améry übernommenen Stichwort der ‚unverschleierten Subjektivität‘ diskutierte Barricelli die Frage der ‚Authentizität‘ von Zeitzeugenberichten, die mittlerweile die Begriffe ‚Emanzipation‘ und ‚Autonomie‘ aus den Curricula verdrängt habe. Die mit ‚Authentizität‘ verknüpfte Unhinterfragbarkeit von Zeitzeugenberichten stelle ein didaktisches Problem dar; Zeugenaussagen vor Gericht seien hingegen gerade dazu da, hinterfragt zu werden.
Die ‚Unberechenbarkeit‘ der Sinnbildungsentwicklung führte Barricelli auf unterschiedliche, konfligierende Deutungsmächte und Geltungsansprüche zurück. Sie müsse im methodischen Umgang berücksichtigt werden: eine Zeitzeugenerzählung liefere primär keine Fakten, sondern ‚subjektiv wahrgenommene Wirklichkeit‘.
Mit Bezug auf den Literaturwissenschaftler Geoffrey Hartman formulierte er die These, durch Bezeugen des Zeugnisses werden die Hörenden selbst zu Zeugen, und leitete daraus die Forderung nach einer ‚Authentizität in der Rezeption‘ ab, die zu einem ‚moral engagement‘ in der Bereitschaft zuzuhören führe. Allerdings dürften ‚Täter‘ nicht als Zeitzeugen fungieren, schließlich sei auch vor Gericht der angeklagte ‚Täter‘ berechtigt, zu lügen, um sich nicht selbst zu belasten. Das von Hartman zitierte, von Rezipierenden in der Zeitzeugenarbeit zu fordernde ‚long-term intergenerational commitment‘ deutete er als aktuelle Forderung, vollständig über eine vergangene Zeit informiert zu werden.
Daran anschließend ging die Psychologin Katharina Obens, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Jüdischen Museum Berlin, am Beispiel ihres Dissertationsprojekts zur Rezeption von Zeitzeugen des Nationalsozialismus auf die Rolle von Vorwissen, Haltungen und Rahmenbedingungen ein, durch die die Rezeption – insbesondere von Jugendlichen – in der Arbeit mit Zeitzeugen beeinflusst werde.
Mit dem Anspruch, in der ‚Mikroperspektive‘ auf psychologische Faktoren von ‚affektiver Aufarbeitung‘ einzugehen, erläuterte sie − ebenfalls mit Bezug auf Jean Améry − die Dringlichkeit und Emotionalität von Zeitzeugenberichten. Die Darstellung von ‚Geschichtsgeschichten‘ (Volkhard Knigge) sei zwar scheinbar ‚glatt‘, aber als ‚sinnstiftende Identitätserzählung‘ immer auch kognitiv und emotional überlagert. Ein komplexes Geflecht von erinnerungskulturellen Diskursen, kontroversen historiographischen Meinungen, reziproken Erwartungshaltungen aller Beteiligten, verschiedenen Zugehörigkeiten und Projektionen u. a. m. betreffe alle beteiligten Akteure und entziehe sich teilweise in der Gesprächssituation rationaler Steuerbarkeit. Obens wies in diesem Zusammenhang auf ‚latente Dimensionen historischer Sinnbildung‘ auf Seiten aller beteiligten Akteure und auf die These hin, Schülerinnen und Schüler seien deutlich vom jeweiligen ‚Familiengedächtnis‘ (Maurice Halbwachs) geprägt. Ausgehend von der Annahme, emotionale Kompetenzen und Emotionen (z. B. Empathie, Scham, Schamabwehr, Schuldabwehr u. a.) üben großen Einfluss auf das Lernen aus, stellte sie eine empirische Stichprobe ihrer Studie sowie Ergebnisse zu Nachhaltigkeit oder Langzeitfolgen von Zeitzeugenarbeit vor.
Abschließend formulierte Obens die Hypothese der besonderen Gedächtniskraft von mit Emotionen verbundenen Erinnerungen oder Informationen und betonte die Notwendigkeit von Vor- und Nachgesprächen, besonders bezüglich der ‚Authentizitätserwartungen‘ in der Arbeit mit Zeitzeugen.
Die Berliner Zeithistorikerin Dr. Sabine Moller vertrat als ehemalige Mitarbeiterin des von Harald Welzer geleiteten Forschungsprojekts „Tradierung von Geschichtsbewußtsein“ und als Mitherausgeberin des daraus hervorgegangenen Bandes „‘Opa war kein Nazi‘. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis“ (2002) eine sozialpsychologische Perspektive, indem sie Faktoren speziell der familialen Sozialisation im Ost-West-Zusammenhang analysierte.
Sie betonte, die Erinnerungserzählungen etwa von Eltern als nichtöffentlichen, ‚impliziten Zeitzeugen‘ gehen meist nicht in das ‚kulturelle Gedächtnis‘ (Jan Assmann) ein, seien aber auch schon bezüglich der Geschichte des Nationalsozialismus ebenso wie mit Bezug auf die Geschichte der DDR im Familienkontext durchaus als Berichte ‚expliziter Zeitzeugen‘ aufgetreten. Als Zeitzeugen habe ihr Interviewprojekt zur Tradierung von NS-Geschichte all diejenigen Personen aufgefasst, die die jeweilige historische Zeit bewusst erlebt haben.
Ein wichtiges Ergebnis ihrer Studie sei der Befund einer bruchlosen Übertragung von gegenwärtigen emotionalen Eindrücken auf die erzählte Vergangenheit durch die Rezipierenden. Moller zog daraus zwei Folgerungen: Zeitzeugen als ‚anwesende Quellen‘ passen sich dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext an. Diese ‚Gegenwärtigkeit‘ der Zeitzeugen lasse den Konstruktionscharakter von Erinnerungen, die sich an den wahrgenommenen Erfordernissen der Gegenwart orientieren, allzu leicht übersehen.
Ein anwesender Zeitzeuge verfertige die Geschichte in Zusammenarbeit mit den Gesprächspartnern und weiteren potenziellen Zuhörenden. Im Begriff der ‚Erinnerungsmuster‘ (Ulrike Jureit) fasste Moller jene fortschreitenden Verschränkungen von Erfahrungen und Diskursen in den lebensgeschichtlichen Erinnerungen, die es ‚aufzuspüren und analytisch zu durchdringen‘ gelte. Sie vertrat dabei die These, solche ‚Erinnerungsmuster‘ erschließe erst eine entsprechende Transkription, mithilfe derer die nötigen Transferleistungen zur kritischen Distanz ‚sich von selbst ergeben‘ sollen.
Der ‚emotionale Rahmen von face-to-face-Interaktionen‘ fördere Neugier und Aufmerksamkeit, aber auch methodische Kompetenzen zur Quellenkritik müssten im Unterricht gestärkt werden. Bei eigenen Familienangehörigen sei eine derartige kritische Herangehensweise an ‚Familienerinnerungen‘ jedoch nahezu unmöglich, da nicht nur im familialen Kontext die Geschichtstradierung bestimmende ‚Loyalitätsbindungen‘ bestehen
Diskussion:
Zur Einleitung der Diskussion fragte die Moderatorin Gundula Klein (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland), worin ein realistisches Lernziel bei Zeitzeugenarbeit bestehen könne. Michele Barricelli betonte, ein Zeitzeuge sei eine narrative und ‚ganz besonders‘ moralisch-ethische Figur, der gegenüber man eine besondere Haltung einnehmen müsse; daraus folge, dass sie nicht auf die gleiche Weise analysiert werden dürfe wie ‚normale‘ Quellen. Insofern müsse es auch um außergewöhnliche, moralische Kompetenzen gehen. Katharina Obens hingegen verwies eher auf Frage- und Orientierungskompetenzen; auch Geschichtswissen spiele in der Zeitzeugenarbeit eine große Rolle, da informiertere Zuhörende gezielter und mutiger Fragen stellen und dadurch auch mehr lernen. Sabine Moller nannte ihrerseits Sozialkompetenz als ausschlaggebend und wandte sich gegen die Annahme, methodische Kompetenzen könnten in der Zeitzeugenarbeit vermittelt werden.
Dorothee Wierling fragte ihrerseits, welche Kompetenzen ungeachtet der tatsächlichen Effekte ermöglicht werden. Im Gegensatz zu Michele Barricelli war sie der Meinung, bestimmte Teile von Transkriptionen seien genau wie eine ‚normale Quelle‘ zu interpretieren. Sie wandte sich jedoch gegen ‚Regeln für die Oral History‘ und stellte das wiederholte Lesen von Transkriptionen dagegen.
Stefan Querl (Villa ten Hompel) problematisierte die harte Trennung von ‚Tätern‘ und ‚Opfern‘ in der von Barricelli präsentierten Sichtweise. Entsprechend wies Katharina Obens darauf hin, dass an Zeitzeugenarbeit beteiligte Jugendliche von sich aus Multiperspektivität einfordern. Auch Sabine Moller wandte sich gegen einen normativen Zeitzeugenbegriff, vielmehr seien erkenntnistheoretisch als ‚Quellen‘ alle gleich zu behandeln; – geschichtskulturell hingegen werden praktisch Unterschiede gemacht.
Abschließend stellte Michele Barricelli die Hypothese auf, ein Zeitzeuge zeuge für das ‚Noch-nicht-Historisiertsein‘ einer Epoche.